Literaturwerkstatt 2015 mit Texten von Lara Kinzel, Anna Wickenhöfer, Florian Fritz, Marc Zenzius, Thy Thy Ta, Eric Altmann, Bianca Helbach und Leonie Merten



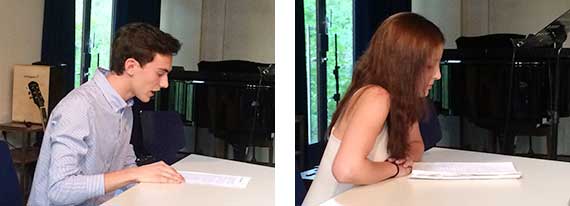




Der Tag, der alles ändert, ist meistens eine Nacht
Er öffnete leicht die Lippen und ließ den Rauch aus seinen Lungen entweichen. Es bildete sich eine weiße Wolke, die sein Gesicht umtanzte. Der Geruch von Nikotin vermischte sich mit dem von Schweiß und Bier, der sich in der Tapete des Raumes festgesetzt hatte, die in den Ecken schon abzublättern begann. Ein Ventilatorblatt verfolgte das andere, es schien eine unendliche Jagd zu sein.
Außer dem Summen des Ventilators hallte nur das stetige Klicken des Kameraverschlusses an den Wänden wider.
Der Blick durch die Kamera umrahmte die Szene und das schwarz-weiße, farblose Abbild erschien ihr so viel echter als die Realität.
Er lenkte seine Aufmerksamkeit auf die Fliege, die auf dem vergilbten Blumenmuster an der Wand herumkrabbelte und die Füße aneinander rieb, fast so, als würde sie sich hämisch grinsend über einen fiesen Plan freuen, den sie gerade ausheckt hatte. Während er das Insekt mit den Augen verfolgte und erneut an der Zigarette zog, hatte sie aufgehört Fotos zu machen, jedoch schaute sie immer noch durch die Kamera und beobachtete ihn, seinen Oberkörper, seine Augen, seine Lippen.
Sie verlor sich in Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, Zeiten, in denen seine Aufmerksamkeit noch ihr galt, Zeiten, in denen sie jeden Abend Arm in Arm eingeschlafen waren. Sie waren Fremde geworden. Die kleine heruntergekommene Wohnung war nur das Ebenbild ihrer Beziehung, das Produkt eines zerstörerischen Prozesses. Als es angefangen hatte so zu werden, hatte sie sich täglich gefragt, wie es so weit kommen konnte, was sie falsch gemacht hatten. Irgendwann hatte sie es einfach hingenommen, sich nicht mehr dagegen gewehrt.
Sie wechselten kaum noch ein Wort miteinander, wenn sie abends nach Hause kam, fragte er sie nicht mehr, woher sie kam und wenn sie morgens wieder das Haus verließ, wollte er nicht wissen, wohin sie ging.
Einige Male schon, hatte sie mit dem Gedanken gespielt, einfach ihre Kamera einzupacken und die Stadt zu verlassen. Was hielt sie davon ab? Waren es ihre Gefühle? Oder war es nur die Erinnerung an die Gefühle?
Sie war so sehr in Gedanken versunken, dass sie nicht bemerkte, dass er sich bereits zum Gehen gewendet hatte. Erst als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, schreckte sie auf.
Ihr Blick fiel auf die Handtasche neben der Tür. Er hatte sie ihr geschenkt, zum ersten Jahrestag. Sie war früher rot gewesen, doch das Leder hatte sich mit der Zeit abgenutzt und die Farbe war verblichen. Ihr war bewusst, dass niemand sie zurückhielt und doch wusste sie, wenn sie jetzt durch die Tür gehen würde, würden kalte Hände sie zurückstoßen, sie würden an ihr zerren, ihr den Weg versperren. Sie wusste nicht, ob sie sie die Kraft aufbringen konnte, gegen die Hände anzukämpfen und die Angst vor der Enttäuschung war zu groß. An diesem Abend kam er nicht mehr nach Hause. Obwohl sie wusste, dass sie heute Nacht alleine schlafen würde, lag sie auf ihrer Seite des Bettes, sodass er sich jederzeit zu ihr legen könnte, würde er heimkommen. Sie war unruhig und konnte keinen Schlaf finden, deshalb spielte sie mit der Kamera, probierte verschiedene Einstellungen aus, betrachtete durch sie das Schlafzimmer. Der Raum war ebenso kahl wie das Wohnzimmer, es gab kaum persönliche Gegenstände, nur eine braune Holzschachtel, in welche ihr Lieblingszitat eingeritzt war: Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.
Seit sie ihre erste Kamera hatte, bewahrte sie dort ihre Fotos auf. Fotos, die ihr Leben beschrieben, Fotos die Geschichten erzählten. Sie fokussierte das Zitat und drückte den Auslöser. Sie legte die Kamera auf den Nachttisch und schloss die Augen.
Am nächsten Morgen fiel ein erster warmer Sonnenstrahl auf ihr Gesicht, er beleuchtete die Holzschachtel, auf die ihr Blick fiel, als sie die Augen öffnete.
Auf einmal wurde es ihr klar. Wie ein Schlag ins Gesicht fühlte es sich an. All die Monate war sie blind durch ihr Leben gelaufen, sie hatte es nicht wahrhaben wollen, hatte sich die ganze Zeit selbst belogen. Sie war unglücklich. Unglücklich über ihr Leben, über ihre Beziehung, unglücklich über das, was sie erreicht hatte, und über das, was sie nicht erreicht hatte. Niemand, außer ihr, konnte das ändern.
Sie hatte die Wahrheit vor sich selbst versteckt, Ausreden für ihre Situation gesucht, auf eine Veränderung gewartet. Doch diese Veränderung würde nicht kommen, wenn sie nicht handelte.
Sie musste weg, frei musste sie sein, sie war so jung, es lag so viel vor ihr, eine riesige, weite Welt, die sie mit offenen Armen empfangen würde, Tausende von Menschen warteten darauf, ihr zu begegnen, Orte, von ihr erkundet zu werden. Nichts mehr hielt sie fest.
Und er? Was war mit ihm? Sie wusste, dass auch er unglücklich war. Sie konnte nicht einfach gehen und ihn seinem Leid überlassen. Eilig raffte sie sich auf, wühlte in Schubladen, fand, was sie suchte. Einen Zettel und einen Stift. Darauf kritzelte sie die letzten Worte, die ihr gestern vor dem Einschlafen durch den Kopf geflogen waren: Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Erfüllt von neuer Lebensenergie lief sie durch die Wohnung, füllte die Tasche mit allem, was wichtig für sie war. Zuletzt hängte sie sich die Kamera um ihren Hals. Bevor sie die Wohnung das letzte Mal verließ, legte sie den Zettel auf den Küchentisch.
Als sie die graue Stadt hinter sich gelassen hatte, kam die Sonne, die sich vorher hinter den Wolken versteckt hatte, wieder hervor und tauchte die Welt in ein warmes, goldenes Licht. Der Frühlingswind umspielte ihr Haar und ein süßlicher Duft von Blumen stieg ihr in die Nase. Jetzt wusste sie, dass sie frei war und zum ersten Mal seit Monaten nahm sie den Schwarz-Weiß-Filter von ihrer Kamera, schaute durch die Linse und hielt den Moment in all seiner Farbenpracht fest.
Lara Kinzel (Q2)
Ein falscher Schritt
Geduckt schlich ich mich vorwärts. Wir durften nicht entdeckt werden, sonst wäre alles vorbei. „Wir müssen weiter nach rechts, sonst sehen sie uns“, flüsterte Karl mir zu. „Nein!“ Ich leitete das Manöver, ich entschied. „Weiter geradeaus!“, gab ich den Befehl. Nur noch ein paar Meter und wir wären in Position. Plötzlich ein Knall. „Sie haben uns gesehen! In Deckung!“ Trotz der Angst, die meinen Körper durchflutete, musste ich einen kühlen Kopf bewahren. „Anlegen und Schießen!“ In schnellen Salven verschoss ich mein ganzes Magazin. In Deckung, nachladen und schießen. Ich funktionierte, sperrte meine Panik zurück. Meine kurze Ausbildung hatte sich gelohnt. Die feindliche Einheit zog sich zurück. Doch meine Freude darüber wurde zu purem Entsetzen. Ich hatte drei Männer verloren. Direkt neben mir lag er, blutüberströmt, mein bester Freund.
Schreiend schreckte ich hoch. Wo war ich? „Guten Morgen Herr Pützler, Zeit zum Aufstehen.“
Ich musste wohl wieder davon geträumt haben. „Morgen“, grummelte ich meinem Pfleger Jan zu. Er hatte sich schon längst an meine Albträume gewöhnt. Widerstandslos ließ ich mir beim Waschen helfen. Zu sehr war ich noch von meinem Traum eingenommen. Ich hatte die Kontrolle verloren, die Deckung verlassen und das Leben meiner Einheit riskiert. Es war meine Schuld, dass drei von ihnen gestorben waren. Ich erinnere mich noch genau an sie. Ferdinand und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Robert. Ihre Mutter brach zusammen, als man ihr die Nachricht überbrachte. Und Karl. Wir kannten uns seit dem Kindergarten. Ich bin schuld, dass er gestorben ist. Ich darf die Kontrolle nicht wieder verlieren! „Herr Pützler!“, Jan riss mich aus meinen Gedanken. „Sie haben mir schon wieder nicht zugehört! Sie sind auf mich angewiesen, oder können sie selbst einkaufen gehen?“ Der Spott in seiner Stimme war unüberhörbar. Betreten guckte ich auf den Boden. Wie lange war ich schon nicht mehr draußen gewesen? Ich kannte die Antwort genau. Fünf Jahre und 73 Tage. Ich hatte akribisch gezählt. Ich hatte ihn damals besucht und auf dem Rückweg einen Schlaganfall erlitten. Die Ärzte meinten zwar, dass es nur ein leichter gewesen sei, aber ich konnte da draußen keinen völligen Kontrollverlust riskieren. Überall waren Gefahren. Auch wenn der Krieg seit 70 Jahren vorbei war, hörte man doch immer wieder von Terroranschlägen und Mördern. Die Welt da draußen war gefährlich! Nur ein falscher Schritt...
Wir waren am Tisch angekommen. Jan hatte schon wieder Frühstück gemacht und wollte mich füttern. Er wollte mir die Kontrolle nehmen. „Ich kann das alleine“, schnell griff ich nach dem Teller mit dem Wurstbrot. Zu schnell. Meine zittrige Hand konnte den Teller nicht halten und er zerbrach scheppernd auf den Fliesen. „Wie kann man nur so stur und ungeschickt sein!“ , schrie Jan und erhob die Hand. Ich war zu perplex, um auszuweichen. Die Erkenntnis traf mich härter als der Schlag. Ich bin hier nicht sicher! Ich habe die Kontrolle nicht mehr.
Erst als der Wind an meiner Kleidung zerrte, merkte ich, dass ich rausgelaufen war. Voller Panik rannte ich weiter. Wohin sollte ich? Nirgendwo war ich sicher! War da jemand hinter dem Baum? Werde ich beobachtet? Mit jedem Schritt wurde ich verzweifelter. Ich merkte nicht mehr, wohin ich lief. Immer weiter, schneller! Wer hätte gedacht, dass ich mit 90 noch so schnell sein kann? Aber Angst holt bekannter weise das Beste aus dem Körper heraus. Jedoch nicht für immer. Erschöpft fiel ich auf die Knie. Mit glasigen Augen sah ich auf. Der Friedhof. Ich musste unbewusst hier her gelaufen sein. Gut drei Kilometer, ohne dass mir etwas passiert war. Niemand hatte mich beachtet. Mit letzter Kraft schleppte ich mich weiter. Zu der Stelle, die ich das letzte Mal vor fünf Jahren und 73 Tagen gesehen hatte, als ich das letzte Mal alleine das Haus verlassen hatte Nur ein falscher Schritt. Ich sank nieder. „Ich werde wieder rausgehen, Karl. Damit du das Leben durch meine Augen sehen kannst.“
Anna Wickenhöfer (Q2)
Ohne Titel
“Warum immer ich?”, fuhr es mir durch den Kopf, als ich durch die Straße lief.
Es regnete und meine Kleidung, völlig durchnässt, klebte an meinem Körper.
“Immer bin ich diejenige, die verletzt wird. Ich habe auch nur Pech. Aber irgendwann musste es so weit kommen und ich muss mich nun mit meinem Schicksal abfinden.
Dass dies keine leichte Sache wird, war mir von Anfang an klar.
“So so, heute ist also der Tag, an dem das, was ich schon seit Wochen ahnte, passiert ist”, dachte ich, als ich Unterschlupf in einem kleinen Kaffee suchte. Es schien als wäre ich hier der einzige Gast.
Ich hing meine Jacke an der Garderobe auf, was ich sogleich bereute, denn unter dieser bildete sich schnell eine große Pfütze. “Naja, draußen ist ja auch ein Sauwetter.”
Ich ging zu einem Tisch, ich hatte mir einen Platz für vier ausgesucht. Ich mag es einfach viel
Platz zu haben, auch wenn ich nicht viel Platz benötige.
Schnell kam ein Kellner und begrüßte mich mit einem freundlichen Lächeln. “Was darf’s denn sein, junge Dame?” Junge Dame?! Das war gut, er schien selbst erst Anfang zwanzig zu sein. „Einen großes Stück von ihrer Schokoladentorte und einen großen Cappuccino, bitte.” “Ist da jemand etwa traurig?”, fragte er mindestens genauso betrübt wie ich traurig war.
Er tat mir leid. Nur ein Gast und dann noch eine traurige 17-Jährige, aber ich konnte es nun mal nicht ändern. Dinge passieren.
“Schon gut”, erwiderte ich, während ich meine Tränen unterdrückte.
Er ging wieder und während er meine Bestellung vorbereitete, merkte ich, wie er mich immer
wieder ansah. Ich zückte mein Smartphone, um zu schauen, ob ich eine Nachricht erhalten hatte. „Alles Pisser”, fluchte ich verärgert über meine vermeintlichen Freunde, die sich nicht mal in dieser für mich schrecklichen Situation um mich kümmerten.
Der Kellner kam und stellte mir meine Sachen mit einem freundlichen Lächeln hin.
„Ich habe nur einen Cappuccino bestellt…”, sagte ich verdutzt darüber, dass er mir zwei hinstellte. „Das weiß ich. Ich möchte aber auch einen trinken. Mit dir. Was ist los?”
Ich wusste nicht, ob ich ihm trauen sollte, gerade in dieser Situation, in der mich so viele
Menschen verletzt hatten, wollte ich nicht meine Gefühle jemandem offenbaren, den ich gerade zum ersten Mal gesehen hatte.
„Scheiß drauf”, seufzte ich und begann ihm mein Herz auszuschütten.
Ich erzählte stundenlang darüber, wie es dazu kam, dass ich nun hier in diesem Kaffee saß.
„…Ich kann mich auf niemanden mehr verlassen. Alle Heuchler. Meine Freunde, die eigentlich immer für mich da sein sollten, sind pure Enttäuschungen. Niemand ruft mich an und fragt mich , wie’s mir geht, obwohl sie alle wissen, was passiert ist”, ich begann wieder zu schluchzen.
„Komm schon, das Leben ist viel zu schön, um Trübsal zu blasen.“-„Aber ich kann nicht anders. Weißt du eigentlich, wie es ist, wenn dich jeder im Stich lässt und du niemanden mehr hast?,Wenn du dich fühlst, als wäre dir das Herz bei lebendigem Leibe rausgerissen worden? Ich weiß das! Denn ich mache das gerade durch“, sagte ich, während mir die Tränen in die Augen schossen. Ich konnte nicht mehr hier sein, ich wollte nur noch nach Hause. „Der Rest ist für dich“, sagte ich, während ich ihm zehn Euro auf dem Tisch warf.
Ich nahm meine Jacke und ging im strömenden Regen nach Hause.
Zuhause angekommen musste ich mich erst einmal hinlegen, ich konnte diese Qualen nicht mehr ertragen, es war die einzige Möglichkeit , sie wenigstens für ein paar Stunden zu vergessen.
Schlaf. Das war, was ich brauchte.
Aber auch dieser wurde mir nicht gegönnt. Meine Mutter kam herein und fragte, was mit mir los sei. „Nichts, mach dir keine Sorgen. Ich fühle mich nur nicht so gut!“, erwiderte ich. „Und warum hast du dein Handy in einem Kaffee vergessen? So verpeilt bist du doch sonst auch nicht?!“ Handy? Kaffee? Mist!
Ich musste es vor lauter Aufregung vergessen haben, aber woher wusste meine Mutter das?
„Hä? Woher weißt du das?“
Sie erzählte mir, dass vor einer Stunde ein junger Mann da gewesen sei und mein Handy
vorbeigebracht habe, sie habe ihm einen Finderlohn angeboten, er aber habe mit den Worten: „Passt schon, habe ich gerne gemacht“, abgelehnt. Alles, was er wollte, sei meine
Nummer gewesen.
Ich rief ihn sofort an, um mich dafür zu bedanken, dass er mir mein Handy zurückgebracht hatte.
Wir redeten stundenlang, und ich erzählte ihm alles. Von meiner Vergangenheit und darüber wie das, was am heutigen Tage passiert war, zustande gekommen war.
Er erzählte mir, dass ich ihm sehr leid getan habe und mir, als er mein Handy gesehen habe,
sofort nachgelaufen sei, um es mir zu bringen.
Von dort an trafen wir uns immer öfter und wir wurden beste Freunde.
Zumindest dachte ich dies.
Eines Tages, es war inzwischen Sommer geworden, waren wir verabredet. Wir wollten einen
Freizeitpark besuchen und ich ihm meine Liebe gestehen.
Der Tag fing nicht besonders gut an. Meine Mutter meckerte mich sofort an, da ich eine 6 in
Mathe nach Hause gebracht hatte.
Sie tat das immer. Sie war fixiert auf Leistung. Leistung, das war alles, was bei ihr zählte.
Ihr Interesse galt nicht meinen Gefühlen, sondern meinen Noten, egal, ob ich daran innerlich
zerbrach. „Nun gut“, dachte ich mir, nachdem ich die Standpauke über mich hatte ergehen lassen. Dieser Rückschlag konnte meine Freude dennoch nicht trüben, denn der Gedanke ihn gleich zu treffen und ihm endlich nach so langer Zeit meine Liebe zu gestehen, zauberte mir ein Lächeln ins Gesicht. Ich spürte auch, dass der mich liebte. Meine Liebe schien also erwidert. Je näher der Zeitpunkt unseres Treffens rückte, desto aufgeregter wurde ich. Ich musste an alles denken, was wir bis jetzt zusammen durch gemacht hatten. Die guten und die schlechten Zeiten.
Ich war schon circa eine Stunde früher da, damit ich mir noch einmal den gesamten Ablauf durch den Kopf gehen lassen konnte. Zuerst würden wir Achterbahn fahren, dann Freefall-Tower und auf dem Riesenrad würde ich ihm meine Liebe gestehen.
Nun war der Zeitpunkt gekommen, er kam und ich sah, dass er jemanden dabei hatte. Einen
Freund?
Wie konnte er zu dem Treffen, was das bedeutendste unseres Lebens werden sollte, jemanden mitbringen? „Wer ist das?“, fragte ich enttäuscht. „Das ist Marie, wir sind seit gestern zusammen. Wusstest du das noch nicht? Ich dachte ich hätte es dir erzählt.“
„Nein, das hast du zufälligerweise nicht.“ Ich war wutentbrannt. Mein Zorn stieg mir zu Kopfe und mein Blut kochte. Ich konnte es nicht fassen, dass er keinen blassen Schimmer hatte, was er da mit mir machte. Er zerstörte alles, was ich hatte. Alles woran ich glaubte.
Mein Antrieb, unsere Liebe, war erloschen. Ich ging, ohne ein weiteres Wort zu sagen „Nur keine Schwäche zeigen“, murmelte ich in mich hinein, während ich versuchte meine Tränen zu unterdrücken. In sicherer Entfernung suchte ich eine Apotheke auf. Meine Kopfschmerzen waren unvorstellbar. „Eine Schachtel Paracetamol.“ „Hier bitte, aber nehmen sie maximal drei täglich.“ Ohne ein Wort zu sagen, nahm ich die Schachtel und ging in einen Park.
Auf einer Bank kam ich schließlich zur Ruhe. Ich konnte das nicht mehr. Ich musste mit
jemandem reden. Aber niemand war für mich da. Ich war so enttäuscht. Nur von wem?
Die Antwort war eindeutig. Ich war enttäuscht von mir. Und so öffnete ich die Schachtel und nahm langsam alle enthaltenen Tabletten. Spürend wie ich immer müder wurde, legte ich mich auf die Bank. Das letzte, was ich mitbekam, war, dass mich eine Passantin versuchte wachzurütteln.
Mit meinem letzten Atemzug entschwand nicht nur das Leben in mir, sondern auch meine Hoffnung.
Florian Fritz (Q2)
Oyuncu- der Spieler
Noch in der Luft durchzuckte der erste Lichtstrahl die tiefblaue Glasmurmel und enthüllte ihre innere fast farblose Muschelspirale, die in ihrer Drehbewegung schien, als würde sie in den tiefblauen Ozean beruhigende unaufhörliche Wellen schlagen. Noch zuvor von der Dunkelheit verborgen durchritt sie die Luft.
Oyuncu hört das dumpfe Aufkommen und helle Klirren von Glas auf Glas, ähnlich dem Klang von Gläsern wie sie beim Anstoßen klingen. Für einen Moment fühlte er sich wieder in den vorigen Abend versetzt, wie er mit seinen Eltern in der einzigen, aber dafür rauchigen Kneipe seines Ortes dasaß und unter dem Gewubbe der Banditen mit seinen Freunden energisch über die neusten Murmeln stritt.
Seine Kugel lag außerhalb des Lichtkegels der Straßenlaterne, die gerade erst angegangen war, doch Oyuncu war sich bereits sicher, seine Kugel war wieder einmal besser positioniert als die seines Freundes. Er war der beste Murmelspieler seiner ganzen Schule und immer, wenn sie sich abends trafen, um im künstlichen Licht der flackernden Laternen zu spielen und die Murmeln weite Schatten warfen, wie sie so aus den Kinderhänden glitten und in den Kuhlen aufeinandertrafen, spürte Oyuncu nur den Adrenalinrausch mit dem klirrenden Aufkommen der Kugel .
Und wenn die Mütter so riefen und er über den Schulhof nach Hause schlurfte, da fühlte sich Oyuncu unglaublich reich und mächtig, denn er ging an keinem vorbei, den er nicht schon abgezogen hatte, der ihm nicht wenigstens ein paar Murmeln oder sogar Geld und Münzen schuldete.
Es gab nur einen Jungen, einen Freund, dem er wegen der Schulden nie Druck machte, weil der eine Schwester hatte, die Oyuncu hübsch fand. Er wollte sie heiraten, sie kannten sich und sie mochten sich auch.
An diesem Abend ging Oyuncu aber nicht nach Hause, seine Eltern waren wieder einmal aus und er wollte die freie Zeit nutzen, um eben diesen Freund zu besuchen. Die Eltern seine Freundes begrüßten ihn erfreut und so ging er ein Stockwerk hoch zum Zimmer seines Freundes und als er, wie so oft schon, merkte, es war verschlossen, so klopfte er und während er wartete, sah er durch einen Spalt ins Nachbarzimmer, dort saß Aisha vor ihrem Spiegel, ihr volles gelocktes Haar umspielte ihr wunderschönes Gesicht, dominiert von ihren großen, tiefen Augen.
Und Oyuncu merkte in seiner ihn völlig überkommenden Bewunderung nicht, dass sie ihn ebenso ansah. Sie bat ihn in ihr Zimmer und wie sie nebeneinander auf ihrem Bett saßen, da merkten sie, dass sie das erste Mal miteinander alleine waren und sie gestanden sich in Flüstertönen ihre Liebe. Der Sommer begann und so ihre Liebe mit ihm. Das exzessive Murmelspielen wich scheinbar endlosen Nächten im gefleckten Schatten der Bäume an der ruhigen tiefblauen Küste, jede Bewegung spiegelte sich auf der sich langsam wiegenden Wasseroberfläche und ihre Spiegelbilder verschwommen ineinander. Wie die Schatten wieder länger wurden und die Tage kürzer, so schien es, neigte sich auch ihre scheinbar unendliche Nähe dem Ende entgegen. Während Aisha die winterlichen Tage weiter an der türkischen Küste verweilte, zog das Leben Oyuncu nach Deutschland. Für immer.
Ohne Aisha begann das Leben in Deutschland für Oyuncu ernüchternd. Er rang lange mit sich, dem Murmelspiel wieder Zuwendung zu schenken, er musste sich eingestehen, dass ihn das Murmeln beherrscht hatte, keineswegs eine Sucht, vielmehr ein einfacher Drang. Dieser einfache Drang, der in den Tagen nach seiner Ankunft immer mehr wuchs und von keiner Liebe überschattet wurde, begann ihn bald wieder zu beherrschen und er ging nun auch los, die Murmelspieler aufzufinden. Des Morgens, dem Drang erlegen, erhellte ihm der Tag einen Brief aus der fernen Heimat. Dem Schreiben seiner Tante entnahm er, Aisha dachte wohl noch immer an ihn, auch lag ein Gedicht von ihr anbei, er nahm sich fest vor, des Mittags gleich zu antworten. Doch diese freudige Kunde bedeckt seinen Drang des Emporkommens keineswegs. Mit sicheren Schritten betrat er dann des Abends eine Kneipe, das Auge stets geschärft für die Murmelspieler dieses Landes. Der Unauffindbarkeit der Murmelspieler und des letzten Bieres überdrüssig, versunken in Erinnerungen an seine Kindheit in der Türkei, fiel ihm auf, es hält ihn nichts an diesem Ort, er war so kalt, so anders als die Heimat. Doch da, da hörte er es doch sehr wohl, es war ein Wubb und da noch einmal, es klang nach Klirren, nach Murmelklirren aus der Kindheit und da er sich so umdrehte, da ward ihm klar. Es war der Klang aus seiner Kindheit, doch keineswegs war es das Murmeln, es war das Gewubbe der Banditen, in seiner Kindheit stets präsent.
-Hätte ein Freund neben ihm gesessen, er hätte ihn gewiss abgehalten, aber da dieser Bandit Oyuncu doch als einziges an seine Heimat erinnerte und an dem Begriff Heimat hing für ihn so viel: Liebe, Geborgenheit, Freunde und das Adrenalin der Murmeln setzte er sich, wohlgemerkt mit Vorsicht, vor den Slot.-
Die Maschine blinkte ihn an und er starrte in die Lichter. Zwei Anzeigen, auf der oberen drehen sich die fünf Rädchen, auf der unteren drei Knöpfe: Start, Stopp, Automatik. Wubbwubbwubbwubbwubb, ein warmes Geräusch, kein Klickern, kein Fiepen, beruhigendes Blubbern. Symbole leuchteten auf und tauchen das Gesicht des Spielers in wechselnde Farben. Er gewann. Noch einmal drückte er auf den Startknopf und schließlich noch ein drittes Mal, das Adrenalin schnellte mit der Höhe des Einsatzes ins Unermessliche. Das Leuchtschild sagte: „The Sky is the limit“. Es wurde spät, sollte er nach Hause gehen, er schaute in seine Geldbörse, gefüllt mit den gleichen, aber nicht denselben 50 Euro wie zu Beginn des Abends. Er drückte weiter auf den Startknopf, immer schneller und spielte ein bisschen mit der Automatik, die viel Adrenalin und noch mehr, Verlust für ihn bedeutete. Der Gewinn war am Ende der Nacht oder man musste vielmehr sagen am Anfang des Tages noch da und der Spieler, nur noch ein Schatten seiner selbst, ging nach Hause. Es vergingen Nächte, bis eines frühen Morgens, der Spieler hatte wieder einmal lange gespielt, mit dem ersten Morgenlicht auf dem Heimweg sich wieder Leben in ihm regte, ihm wurde klar, dass an Aisha noch eine Antwort ausstand. Zu Hause angekommen, überflog er ihren Brief noch einmal. Der Brief begann mit „Lieber Oyuncu“ O-O-Oyuncu? Der Spieler begann zu schreiben:
Liebe Aisha,
Ich schreibe dir geschwind
Doch es ist nicht der Wind
Das bin doch eben ich
Der sagt, man denkt an dich
Reich lieber deinen Arm
Du hast ja grad nur einen
Ich bin nicht gerade lahm
schnell her mit allen Scheinen
Bin nicht mehr lange fort
warte ruhig auf mich dort
Es wird sicher ein Brillant
Ein Geschenk aus Deutschland
Noch am selbigen Morgen schickte er den Brief auf die weite Reise, zurück in seine Heimat. Er fühlte sich wie ausgewechselt, mehr wieder wie Oyuncu, als wäre er zuvor nicht er selbst gewesen, doch dieses Gespinst schob er mit allem Unnütz beiseite, es gab jetzt nur noch eins, Aisha und das Ziel, zu ihr zurück in seine Heimat zu kommen. Sicher ihm war klar, dass er in Deutschland schon fest Wurzeln geschlagen hatte, der eine Halunke hie, der andere Lump da.
Doch würde er das alles sicher aufgeben. Des Abends ging er nicht mehr aus, er siedelte sich ein, seine Spitzbuben wunderten sich sicherlich, wo er steckte, doch er dachte nur daran Briefe und Gedichte für seine Aisha zu schreiben und wartete stets sehnsüchtig auf ihre Antworten.
Er konnte sein Glück kaum fassen, eines Tages kam ein Brief aus der Heimat, jedoch nicht von Aisha. Es war seine Tante, die ihm schrieb. Doch bevor er ihn öffnete und er war wirklich gespannt, was sie zu berichten hatte, sie hatten sich lange nicht mehr gesehen, nur wusste er auf Anhieb nicht mehr wie lange, es war auf jeden Fall eine lange Zeit, schaffte er sich an diesem Abend eine Abwechslung und ging in seine alte Stammkneipe zu seiner Gaunerbande. Er war verblüfft, sie standen immer noch in Reih und Glied und warteten nur auf ihn, er hatte wirklich Wurzeln geschlagen in Deutschland. Doch widerstand er zunächst dem sofortigen Verlangen sich an einen von ihnen zu setzten und begab sich an die Bar, holte den Brief seiner Tante aus seiner Jackentasche, öffnete ihn und legte das leere Kuvert neben sein Bier. Bereits auf den ersten Blick sah er, dass sie über Aisha schrieb und da wurde Oyuncu ganz warm ums Herz, das erste Mal seit langem wieder. Er begann zu lesen. Ein ausländischer Soldat habe Aisha aufs Feld gezogen und vergewaltigt. Aishas Vater habe die beiden zur Hochzeit gezwungen. Aisha: weg. All das waren nur leere Worte für ihn, er verstand sie nicht, was hatte das zu bedeuten, was war mit seiner Aisha, was war mit seinem Anker im Ozean, tiefblau- geschlagen? Der Anker, der ihn doch nach Hause bringen sollte, zurück in die Heimat. Er spürte in sich die Stimme, die immer lauter wurde, zuvor noch übertönt vom tiefblauen Ozean, in dem sein Anker der Liebe sich jetzt gelichtet hatte und aus dessen beruhigenden Wellen nun vielmehr tosendes Wellenschlagen ertönte, als wären sie die Stimme selbst, die ihn hinauszog und hinein zugleich, die Stimme, die ihn bei seinen Banditen Ruhe finden ließ. So zog es ihn zu dem Banditen, an dem er auch sein erstes Spiel angefangen hatte, auf seinen Rädchen hatte er Brillanten, Kirschen und eine Zahl.
Die ersten Sonnenstrahlen schienen schon wieder auf den Spieler. Er hatte auf Automatik gestellt. Er machte nichts, er saß, er starrte. Zehn Euro, 9,60; 9,20; 8,80. Es ging schnell, nach ein paar Minuten waren die zehn Euro weg.
„5 Euro noch“, sagte er und steckte einen 20er hinein.
-Ich habe ihn wieder getroffen, vor gar nicht allzu langer Zeit und er sagte mir, er könne die Automaten nicht mehr ausstehen. Er bestellte uns zwei Tee. „Das Leben“ , sagte er , „verlangt Perfektion. Jeder Fehler kostet Zeit und Schmerz“. Er dachte an Aisha, begann zu erzählen, wie er Jahre später, als er durchs Spiel mal reich war, mit dem Cabrio in sein Heimatdorf zurückgekehrt sei, ein Prinz aus dem Märchen. Er habe Aisha abgeholt und sei mit ihr in ein schönes Hotel gefahren und habe noch ein letztes Mal mit ihr geschlafen. „Und weißt du“, sagte er, „dabei ist ein Sohn entstanden. Der ist jetzt Staatsanwalt in der Türkei“. Ob diese Geschichte nun wahr ist oder nur sein Traum, weit weg ist alles auf jeden Fall. Der Spieler blickte aus dem Fenster in die Lichter der Nacht. –
Marc Zenzius (Q2)
Ohne Titel
Ich saß im Zug und starrte gedankenverloren aus dem Fenster. Die Sonne ging langsam unter und der Himmel färbte sich rosa-lila. Völlig erschöpft schloss ich für einen kurzen Moment die Augen und ließ den Tag Revue passieren. Plötzlich bemerkte ich, dass sich jemand neben mich setzte und ein bekannter Geruch stieg mir in die Nase. Es war das Parfüm der Person und sofort wurde ich von der Vergangenheit eingeholt. Erschrocken fuhr ich auf. Ich wollte doch nur mit der Vergangenheit abschließen, doch es war nicht so einfach, wie gedacht.
„Entschuldigung, habe ich dich erschreckt? Ist dieser Platz bereits besetzt?
Ich kann mich auch woanders hinsetzen…“, fragte mich eine ruhige, warme Stimme.
Ich blickte der Person ins Gesicht. Es war ein junger Mann.
„Nein, bleiben Sie ruhig sitzen. Ich habe mich nur erschreckt. Tut mir leid“, erwiderte ich.
„Du kannst mich ruhig duzen. Ist sonst alles in Ordnung bei dir? Du siehst nicht besonders gut aus.“
„Ja, alles in Ordnung. Ich hatte nur ein paar anstrengende Tage, danke der Nachfrage.“
Ich wunderte mich über die Höflichkeit und Fürsorglichkeit des jungen Mannes.
Für eine Weile musterte ich ihn, denn er kam mir unglaublich bekannt vor, aber ich wusste nicht,
woher ich ihn kennen könnte. Er sah aus wie ungefähr 19, hatte faszinierende goldbraune,
warme Augen und seine Kieferpartie war außergewöhnlich markant. Dann fiel mein Blick auf seine Uhr. Irgendetwas fesselte mich an dieser Uhr und ich konnte meinen Blick nicht abwenden.
„Ich sehe, du starrst auf meine Uhr?“, fragte er grinsend.
„Ja, ich habe so eine noch nie gesehen“ , antwortete ich peinlich berührt.
„Sie gehörte meinem Opa. Er hat sie mir geschenkt, als ich noch ein kleines Kind war und
jetzt passt sie mir wie angegossen“, erzählte er.
„Das ist schön, dass die Uhr eine wichtige und große Bedeutung für dich hat“, sagte ich beeindruckt.
„Weißt du, was noch viel schöner ist und noch eine größere Bedeutung hat?“ , fragte er mit einem ernsten Blick. „Was?“ , fragte ich zögerlich. „Die Zeit“, sagte er leise.
„Die Zeit?“, fragte ich überrascht. „Ja, die Zeit. Hast du dir nie darüber Gedanken gemacht, wie viel die Uhrzeit eigentlich bedeutet? Sie begleitet dich von morgens bis abends, du richtest dich nach ihr und ohne sie würde die Welt nur noch pures Chaos sein.“ Er hörte auf zu reden und schien in seinen Gedanken verloren zu sein. Auch ich sagte nichts. Dann fing er an weiter zu reden,
„Die Zeit kann dein bester Freund sein, sie hilft dir deinen Alltag zu organisieren, aber sie kann auch zu deinem Feind werden. Die Zeit rennt und rennt und sie hört niemals auf. Sie macht für keinen eine Ausnahme und stoppt. Versuche die Zeit sinnvoll zu nutzen und genieße die Zeit in vollen Zügen, denn irgendwann läuft deine Zeit ab. Lebe nicht in der Vergangenheit und versuche endlich damit abzuschließen, auch wenn es schwierig ist.“ Ich war sprachlos, denn mit so etwas hatte ich nicht gerechnet. „Ich versuche es wirklich, doch ich werde immer wieder von der Vergangenheit eingeholt. Meine Gefühle spielen mittlerweile verrückt…“
„Gefühle können verrückt spielen, genau so wie die Zeit“, sagte er mit einem traurigen Lächeln.
Ohne ein weiteres Wort stand er auf und stieg aus. Ich war verwirrt, denn ich fragte mich,
was Gefühle mit der Zeit zu tun haben. Und dann fiel mir die Antwort ein:
Man kann weder Gefühle noch die Zeit kontrollieren.
Thy Thy Ta (Q2)
Gedicht
Rotes Morgenlicht durchflutet die Wiesen
Seine Energie und Wärme wird sich ergießen
Über die Blätter der wachsenden Pflanzen
Die im lauen Wind fröhlich umher tanzen
Die Sonne lächelt zum ersten Mal
Welch Schönheit bleibt hier ungesehen
Menschliche Blindheit, törichte Qual
Kann es denn einfach so weiter gehen?
Schrill läutet der Wecker, zieht uns ins Leben
Zwingt uns nach Bildung und Arbeit zu streben
Routine beginnt: kleiden, essen, waschen,
Wieder und wieder packen wir Taschen.
Wir öffnen die Türe und schauen hinaus,
Sehen Autos, Straßen und Menschen -nur grau,
Zwängen uns hinein in den stetigen Stau,
Blindlings agierend wie im Käfig die Maus
Die Luft ist schwül, der Monitor blendet
Künstliches Neonlicht, die Fenster sind zu
Der stinkende Schweiß tropft hinab bis zum Schuh
So harren wir aus, bis die Arbeit endet
Müd und erschöpft kommen wir abends heim
Schalten den Fernseher an und trinken viel Bier
Ertränken des Tages Mühsal im Keim
Vergessen das Dasein wie ein wildes Tier
Rotes Abendlicht durchflutet die Weiden
Wo nun die ersten Pflanzen von uns scheiden
Die Blätter verfärben sich rot, gelb und braun
Verwelken, vertrocknen, verdursten am Baum
Die Sonne lächelt zum letzten Mal
Welch Schönheit bleibt hier unbemerkt
Menschliche Blindheit, törichte Qual
Was ist an unserem Leben nur so verkehrt?
Eric Altmann (Q2)
Ein Mädchen
Sie schaute nach oben, zwischen den Ästen lugte die Sonne durch die Blätter. Lynn staunte. Sie war der Baumkrone und damit der Sonne so nah. Das Sonnenlicht warf Muster auf die Äste neben ihr. Ein leichter Wind ließ die Blätter rascheln. Durch die Bewegung der Blätter schienen die Lichtkegel auf den Ästen zu tanzen. Lynn strahlte vor Stolz. Zwar hatte sie lange gebraucht, um auf den Baum zu klettern, letztendlich hatte sie es aber geschafft. Selbstzufrieden lehnte sie sich an den Baumstamm. Er drückte fest und ungewohnt in ihren Rücken, doch es gab ihr das Gefühl, mit dem Baum verbunden zu sein. Sie fing an zu summen.
Eine Weile betrachtete Lynn ihre Umgebung. Ein Vogel zwitscherte neben ihrem linken Ohr, in der Ferne waren noch mehr Vögel zu hören. Sie entdeckte eine Ameise, die verzweifelt und taumelnd versuchte, einen viel zu großen Brotkrümel zu transportieren. Lynn kicherte.
Da hörte sie ihre Mutter rufen: „Lynn, kommst du? Es gibt Essen!“ – „Ja, Mami, ich komme gleich!“, antwortete Lynn in Richtung ihres Hauses, das gleich nebenan war. Ich war wohl ziemlich lange hier oben, dachte sie, und begann hinunter zu klettern. Ihr war gar nicht bewusst gewesen, wie hoch sie geklettert war. Die ersten Äste waren einfach, doch plötzlich sah sie keinen Ast mehr unter sich, den sie erreichen konnte. Hektisch sah sie sich um. Da musste doch irgendwo ein Ast sein! Aber da war keiner. Je länger sie nach unten schaute, desto weiter weg schien der Boden zu sein. Ängstlich blickte sie nach unten und dann durch die Äste zu ihrem Haus. Ihr Blick blieb an ihrer Mutter hängen, die angelaufen kam.
„Lynn, komm doch endlich vom Baum runter, das Essen wird kalt!“
- „Ich kann nicht Mami, da ist kein Ast!“
Inzwischen neben dem Baum angekommen, sagte ihre Mutter: „Dann musst du springen, mein Schatz. Du schaffst das, sei ein starkes Mädchen.“
- „Aber ich kann nicht, es ist so hoch!“. Sie schrie fast und Tränen liefen über ihre Wangen. Der Boden erschien ihr Kilometerweit weg.
- „Du musst da alleine runterkommen, Lynn!“
Lynn schluchzte. Ich muss springen, dachte sie. Ich muss ein starkes Mädchen sein. Doch ihr wurde inzwischen schon schwindelig, wenn sie auch nur nach unten sah. Der Ast, auf dem sie saß, schnitt in ihr Fleisch. Es tat weh. Der Wind war noch da, doch jetzt ließ er sie frösteln. Die Sonne war hinter einer Wolke verschwunden.
Ich kann es nicht, dachte Lynn. Es ist so hoch, ich kann nicht… Aber ich muss ein starkes Mädchen sein. Ich bin ein starkes Mädchen. Das sagte sie sich. Immer wieder. Ich bin ein starkes Mädchen. Die Tränen versiegten. Sie schaute hinunter. Ich bin ein starkes Mädchen. Sie schloss die Augen, lehnte sich nach vorne und sprang.
Bianca Helbach (Q2)
Vaterliebe
Rupert starrte auf die in orange leuchtenden Ziffern und Lettern, die ihm anzeigten, wie viele Stockwerke ihn noch vom Ausgang trennten. Die silbergrauen Metallwände schienen ihm heute noch beengender als sonst.
In seinem Kopf hallte noch das hitzige Gespräch wider, das er gerade mit seinem Chef geführt hatte.
Er hatte seine Entscheidung längst getroffen.
Wütend war er schließlich aus dem Büro gestürmt, der Chef hatte ihm noch die Kündigung hinterher gerufen.
Doch das kümmerte Rupert nicht mehr.
Endlich leuchtete das große »E« auf der Fahrstuhlanzeige auf und die Türen öffneten sich. Erleichtert stürzte er aus dem Fahrstuhl und eilte, seine Aktentasche in der einen, einen grauen Regenschirm in der anderen Hand haltend, zum Ausgang des Gebäudes. Schwerfällig drückte er gegen die große, gläserne Tür und trat hinaus.
Es war ein grauer Herbstabend, kalter Wind wehte die gefallenen Blätter durch die verlassenen Straßen der Stadt. Rupert knöpfte seinen Mantel zu und bog nach links. Es nieselte ein wenig, deshalb öffnete er kurzerhand seinen Regenschirm. Nach einigen Schritten sah er noch einmal zurück auf die großen, leuchtenden Lettern der Firma, die er nun nie wieder betreten müsste.
Auf seinem Weg kam er wie üblich an den schwach beleuchteten Cafés und Bars vorbei. Hier und da roch es nach indischem Essen und Donuts. An einem schönem Sommertag wären die Läden stark gefüllt, Menschenmassen würden sich durch die Straßen drängen, Verkäufer ihre Ware ausrufen. Die Stadt wäre an einem solchen Tag lebendig, doch heute waren die Straßen leer.
Rupert bog in seine Straße und schritt auf die Eingangstür des Plattenbaus zu. Langsam stieg er die Stufen hinauf in den sechsten Stock und schob den Schlüssel in das Schloss der Wohnungstür. Es klemmte ein wenig, als er den Schlüssel umdrehte, doch nach einem geübten Ziehen und Drücken öffnete sich die Tür und er trat in seine kleine Zweizimmerwohnung ein.
Er stellte seinen Schirm in den Ständer und hing seinen Mantel an den Kleiderhaken. Seine Schuhe streifte er ab und stellte sie in den Schuhschrank, der ebenso als Kommode diente. Auf ihr standen verschiedene Bilderrahmen, die Fotografien von seiner Tochter und seiner Exfrau zeigten. Auch Portraits von seinen Verwandten und Aufnahmen, die ihn mit Freunden zeigten, waren unter ihnen. Es waren Überbleibsel aus einer Zeit, die weit hinter ihm lag.
Lange war es her, dass Rupert etwas mit Freunden unternommen hatte. Sie führten ihre Leben weit fort von ihm. Und zu seiner Familie hatte er schon lange zuvor keinen Kontakt mehr gehabt.
Nachdenklich nahm er eines der Bilder in die Hand, das ihn mit seiner Tochter und seiner Exfrau abbildete. Er fuhr mit dem Daumen über das Gesicht des Mädchens. Vier Jahre war sie alt, als das Foto entstanden war, einige Wochen später war dann der furchtbare Unfall. Sie hatte ihn nicht überlebt. Und er allein war schuld daran. Seine Frau hatte sich danach von ihm abgewandt. Ein halbes Jahr nach dem Unfall ließ sie sich schließlich von ihm scheiden.
Zwölf Jahre war das nun her. Seitdem war er alleine.
Allein sein Job hielt ihn in dieser Zeit am Leben. Doch nun war er es leid geworden, Tag für Tag Akten von der einen auf die andere Seite zu schieben.
Rupert hatte vor, diesen Abend noch einmal zu genießen. Er würde sich ein Glas Rotwein, den er sich für einen besonderen Anlass aufgehoben hatte, einschenken, sich in seinen gemütlichen Lehnsessel setzen und sich einige Episoden seiner Lieblingssendung ansehen. So lief er also in seine kleine Küche, nahm sich aus einem der Schränke ein Weinglas, klemmte sich die Flasche Rotwein unter den Arm und ging damit ins Wohnzimmer.
Einige Stunden vergingen, ehe Rupert den Fernseher ausschaltete und sich müde aus seinem Sessel erhob.
Es war Zeit.
Er schritt den Flur entlang auf sein Schlafzimmer zu. Als er die Tür öffnete, schaute er auf sein Bett und ließ den Blick durch den Raum gleiten, bis sein Blick auf das Seil fiel, das vor ihm von der Decke baumelte und dessen Ende zu einer Schlaufe gebunden war. Es war gerade so angebracht, dass Rupert problemlos vom Bett aus danach greifen konnte. Er lief auf das Fenster zu, unter dem sein Kanapee stand. Darauf lag sein Nachthemd, welches er, nachdem er seine Klamotten abgestreift hatte, überzog.
Langsam schritt er durch das Zimmer zu seinem Nachttisch und griff sich einen der Bilderrahmen, in dem ein Foto seiner Tochter zu sehen war. Er betrachtete es eine Zeit lang. „Ich komme zu dir Prinzessin“, flüsterte er.
Entschlossen stieg Rupert auf das Bett und griff nach dem vor ihm pendelnden Seil. Vorsichtig führte er die Schlinge über seinen Kopf und ließ sie auf seine Schultern fallen. Einen kurzen Moment zögerte er, doch schließlich machte er den Schritt ins Leere – und fiel.
Er fiel nicht tief. Seine Füße baumelten gut 40 Zentimeter über dem Boden. Die Schlinge schnürte ihm den Hals ab und drückte ihm auf den Kehlkopf. Rupert spürte, wie durch den Druck Äderchen in Nase und Augen platzten und schloss die Augen.
Allmählich verlor er das Bewusstsein. Das letzte, an das Rupert dachte, war das Gesicht seiner Tochter. Ein kurzes Lächeln huschte über sein Gesicht, ehe sein Körper schließlich erschlaffte.
Leonie Merten (Q2)

